Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Von der „hohlsten chauvinistischen Überhebung“ und einer „vortrefflichen Kommission“
Die Verhandlungen zur internationalen Meterkonvention vor 150 Jahren in den Briefen von Wilhelm Foerster an den Deutschen Botschafter in Paris
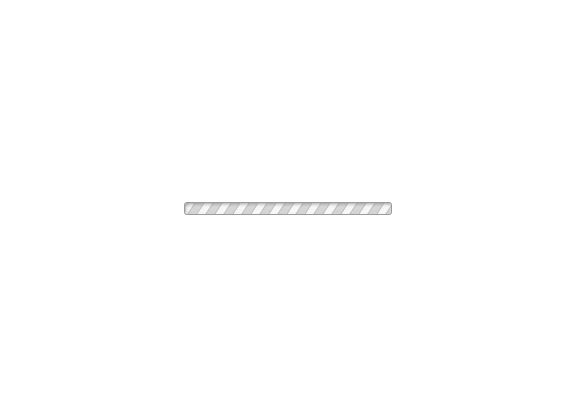
Heute ist der Meter im Alltag – sei es im Baumarkt oder bei Google Maps – eine unverzichtbare und selbstverständliche Maßeinheit. Doch das war nicht immer so. Erst im Jahr 1872 löste der Meter im Deutschen Reich die vielen regionalen Maße wie zum Beispiel den Stuttgarter Fuß mit umgerechnet 28,6 cm oder den Bayerischen Fuß mit 29,2 cm ab. Das Bedürfnis mit einheitlichem Maß zu messen, entstand in Frankreich bereits im Zuge der Revolution von 1789. Für die Definition einer vom Erdumfang abgeleiteten Längeneinheit ermittelten zwei Astronomen die genaue Distanz des Meridianbogens von Barcelona nach Dünkirchen durch Triangulation (Vermessung eines Dreiecksnetzes auf der Erdoberfläche). So konnten sie den 10millionsten Teil des Erdquadranten zwischen dem Nordpol und dem Äquator als Meter bestimmen. Im Jahr 1799 wurden zwei Platinstangen in der Länge eines Meters produziert und als Referenzobjekte im Nationalarchiv in Paris hinterlegt.
Die Einführung einheitlicher Maße und gültiger Definitionen ist eine Grundvoraussetzung für wissenschaftliche, kulturelle und ökonomische Interaktionen zwischen Staaten. Globale Standardisierungen sind jedoch selten ein reibungsloser Prozess, wie auch das Beispiel der Meterkonvention zeigt. Im Jahr 1867 wurde in Paris eine internationale Kommission zur Einführung universaler Längen- und Gewichtsmaße für den Handel und die Wissenschaft gegründet. Auch die Geodäten forderten auf ihrer Konferenz in Florenz 1869 die Erstellung eines in Europa verfügbaren Prototyps des französischen Meters, um die Landvermessung der Staaten zu vernetzen. Erst nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871 war es möglich, die erforderliche internationale diplomatische Konferenz in Paris einzuberufen. An der im Jahr 1875 in Paris stattfindenden Meterkonferenz waren 20 Staaten aus Europa, Nord- und Südamerika beteiligt.
Clemens von Delbrück, Vertreter des Reichskanzlers, beauftragte am 22. Februar 1875 den Botschafter des Deutschen Reichs in Paris, Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, sowie Wilhelm Foerster, den Direktor der Normal-Eichungs-Kommission des Deutschen Reichs, mit den Verhandlungen. In demselben Erlass wies er die Bevollmächtigten an, dass die Kontrolle der herzustellenden Prototypen nicht von Frankreich dominiert werden dürfe, sondern von wissenschaftlichen Kriterien geleitet werden müsse. Hierzu sollte ein dauerhaftes, der Neutralität und Wissenschaft verpflichtetes Kontroll- und Aufbewahrungsbüro geschaffen werden. Bei einer Dominanz der Institution durch Frankreich sei ein Vertragsabschluss nicht möglich und die Errichtung der Institution in der Schweiz in Betracht zu ziehen.
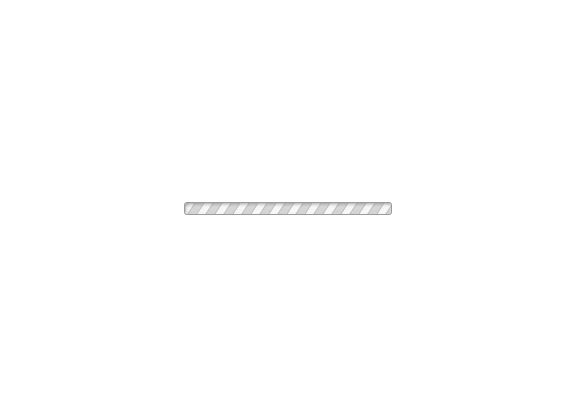
In den folgenden Verhandlungen stand die Ausgestaltung dieser Institution im Fokus der Diskussion. Während das Deutsche Reich die Einrichtung eines ständigen Büros forderte, hatten Russland und Frankreich Vorbehalte gegenüber einer dauerhaften Organisation. Schließlich setzte sich nach vier Hauptverhandlungen der Vorschlag für ein ständiges Büro durch.
In der Überlieferung der Botschaft Paris im Politischen Archiv haben sich fünf Briefe von Foerster an den Deutschen Botschafter erhalten. In diesen unterrichtete der 43jährige Wissenschaftler Hohenlohe-Schillingsfürst von März bis Mai über den Verhandlungsfortschritt.
Während er am 2. April noch sehr emotional und voreingenommen die Haltung der verschiedenen internationalen Partner beschrieb, wandelte sich sein Urteil am 25. April zu einer milderen und optimistischeren Sichtweise. Er lobte die „vortreffliche Zusammenstellung der Teilnehmer“ und die Polemik gegen die französischen Kollegen trat in den Hintergrund. Hoffungsvoll schrieb er, dass „[…] im Frühjahr 1876 […] die erste ordentliche Sitzung stattfinden [wird], bei welcher wir hoffentlich den Bau des Gebäudes beginnen können […].“ Wilhelm Förster war von 1891 bis kurz vor seinem Tod 1921 Präsident des Internationalen Komitees für Maße und Gewichte.
Bildergalerie Internationale Meterkonvention vom 20. Mai 1875 (ausgewählte Vertragsseiten)
Am 13. Mai 1875 erteilte Bernhard Ernst von Bülow im Auswärtigen Amt als Vertreter des Reichskanzlers grünes Licht für die Unterzeichnung des Vertrags, die am 20. Mai im französischen Außenministerium stattfand. Der multilaterale Vertrag wurde in Paris zwischen siebzehn Staaten geschlossen und für diese ausgefertigt, unterzeichnet und gesiegelt. Erstunterzeichner waren Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich-Ungarn, Peru, Portugal, Russland, Schweden, Norwegen, Spanien, Schweiz, Türkei, USA und Venezuela. An der Konferenz beteiligt waren auch die Niederlande, Großbritannien und Griechenland, die dem Vertrag aber nicht beitraten. Botschafter Hohenlohe-Schillingsfürst siegelte mit seinem persönlichen Siegel. Die Ausfertigung für das Deutsche Reich hat sich bis heute im Politischen Archiv erhalten. In Artikel 1 des auf Französisch verfassten Vertrags erklärten die Vertragspartner, dass sie in Paris ein gemeinsames wissenschaftliches Büro für Maße und Gewichte einrichten und finanzieren werden. Die Bevölkerungsgröße der teilnehmenden Staaten bestimmte ihren jeweiligen Finanzierungsanteil. Der Vertrag sah auch die Hinterlegung eines Urkilogramms vor.
Die in der Konvention vereinbarten Regularien führten in der Folge einerseits zum Beitritt vieler weiterer Staaten – bis heute sind es 64 –, andererseits hatten sie viele weitere Verhandlungen unter anderem über die deutlich höheren Kosten zur Folge. Auch die Produktion der sogenannten Prototypen (Kopien des Urmeters) verursachte mehr technische Schwierigkeiten als vorausgesehen. Ihre Bereitstellung erfolgte erst vierzehn Jahre später. Die 30 erstellten Kopien wurden unter den damaligen Mitgliedsstaaten verlost. Das Deutsche Kaiserreich erhielt die Kopie Nummer 18, das Königreich Bayern die Kopie Nummer 7, da es in den Vorverhandlungen noch eigenständig beteiligt war. Im Zweiten Weltkrieg wurden beide Urmeter in das thüringische Weida ausgelagert und verblieben nach 1949 in der DDR. Die nunmehr „maßlose“ Bundesrepublik erwarb 1954 vom für Flandern und Wallonien zweifach ausgestatteten Belgien die Kopie Nummer 23. Seit 1990 verfügt die Bundesrepublik Deutschland über drei der Urmeter, die heute von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig gehütet werden. Sie haben seit 1960 nur noch historischen Wert. Abgelöst wurde der Prototyp in Form eines Stabes durch die Festlegung des Meters in Lichtwellen und seit 1985 als die Strecke, die Licht im Vakuum für die Dauer von 1/299 792 458 Sekunden durchläuft.
Quellen:
Hoppe-Blank, J., Vom metrischen System zum internationalen Einheitensystem – 100 Jahre Meterkonvention, Braunschweig 1975.
PAAA, RAV 204-1/16D.
Freundliche Auskunft der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vom 23. Juni 2025.